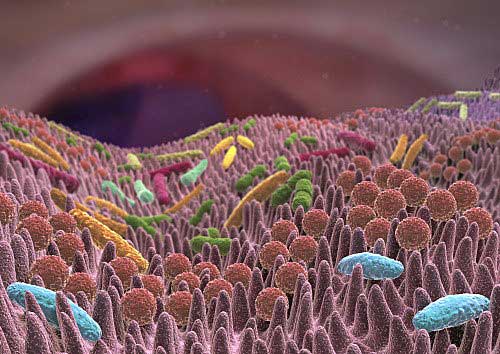Am Samstag, 17. Dezember 2022, 19:15 Uhr (nach der Abendmesse), veranstaltet TRITONUS BRASS in der Pfarrkirche St. Bonifaz in Regensburg ein Konzert, das auf das Weihnachtsfest einstimmt. Die 11 Musiker spielen adventliche und weihnachtliche Musik für zehnstimmiges Blechbläserensemble mit Schlagwerk.
 Konzert der TRITONUS BRASS in Landshut (Foto: TRITONUS BRASS)
Konzert der TRITONUS BRASS in Landshut (Foto: TRITONUS BRASS)TRITONUS BRASS – das Ensemble
Am Ende des Wintersemesters 1987/88 trafen sich – vor 35 Jahren - in Regensburg erstmals 5 Studenten, um als Blechbläserquintett in der klassischen Besetzung (2 Trompeten - Horn - Posaune - Tuba) zu musizieren. Bald stand der erste öffentliche Auftritt an, für den ein Name des Quintetts bekanntgegeben werden musste. Die 5 Musiker waren sich schnell über den Vorschlag von Christian Hopfner einig, dass der "Tritonus" (der Dreitonschritt, der wegen seines besonderen Klanges auch "diabolus in musica", also der "Teufel in der Musik" genannt wird) Motivation und Leitlinie für das gemeinsame Musizieren auf dem musikalisch neuem Weg sein könnte. So war dann der Name gefunden: "Tritonus Blechbläserquintett".
1993 regte Christian Hopfner an, neben der Literatur für Quintett andere Literatur für größere Besetzung zu spielen. Bald waren weitere Musiker gefunden, die an dieser Idee Gefallen fanden. Nachdem der bisherige Name für das Zehnerensemble (4 Trompeten - Horn - 4 Posaunen - Tuba) nicht mehr zutreffend war, erfolgte die Umbenennung in "TRITONUS BRASS".
Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass zu dem Klang der 10 Blechbläser an vielen Stellen Pauken oder modernes Schlagwerk gut passen würde. Nachdem Schlagwerk zunächst nur für Auftritte hinzugenommen wurde, zählt die Stammbesetzung seit 1998 nunmehr 11 Musiker.
1993 regte Christian Hopfner an, neben der Literatur für Quintett andere Literatur für größere Besetzung zu spielen. Bald waren weitere Musiker gefunden, die an dieser Idee Gefallen fanden. Nachdem der bisherige Name für das Zehnerensemble (4 Trompeten - Horn - 4 Posaunen - Tuba) nicht mehr zutreffend war, erfolgte die Umbenennung in "TRITONUS BRASS".
Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass zu dem Klang der 10 Blechbläser an vielen Stellen Pauken oder modernes Schlagwerk gut passen würde. Nachdem Schlagwerk zunächst nur für Auftritte hinzugenommen wurde, zählt die Stammbesetzung seit 1998 nunmehr 11 Musiker.
Abwechslungsreiches Programm
TRITONUS BRASS hat ein abwechslungsreiches Programm für die Advents- und Vorweihnachtszeit vorbereitet. Neben Johann Sebastian Bach, dessen bekanntes „Herrscher des Himmels“ aus dem Weihnachtsoratorium erklingen wird, steht die Bearbeitung der bekannten Chorwerke „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt und „Ave Maria! Von Anton Bruckner für 10 Blechbläser von Christian Hopfner auf dem Programm. Interessante Klangfarben und verspricht die Bearbeitung des Weihnachtsliedes „Joy To The World“ 10 Blechbläser und Schlagwerk von Keith Snell.
Bekannte Advents- und Weihnachtsmelodien
TRITONUS BRASS spielt aber auch bekannte Advents- und Weihnachtsmelodien, z.B. „Engel haben´s kund getan“, „Tochter Zion“, „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ und „Fröhliche Weihnacht überall“.
Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.
Weitere Informationen über das Konzert und TRITONUS BRASS unter www.tritonus-brass.de .
Christian Hopfner
TRITONUS BRASS
c/o Christian Hopfner
Hermann-Köhl-Straße 2 a
93049 Regensburg
Tel.: 0941/4667166
Fax: 0941/4667155
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.tritonus-brass.de
TRITONUS BRASS
c/o Christian Hopfner
Hermann-Köhl-Straße 2 a
93049 Regensburg
Tel.: 0941/4667166
Fax: 0941/4667155
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.tritonus-brass.de










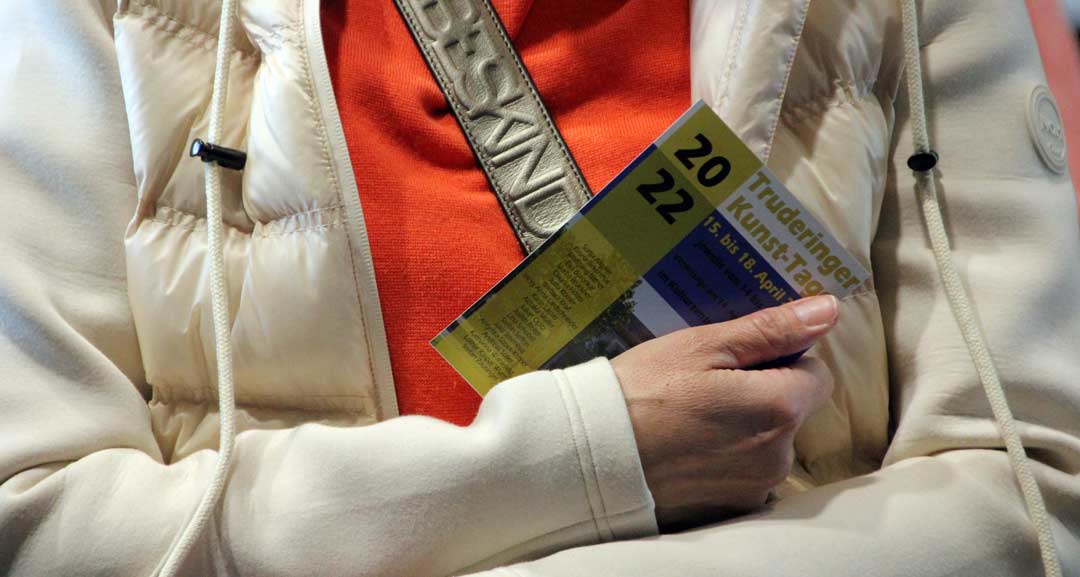
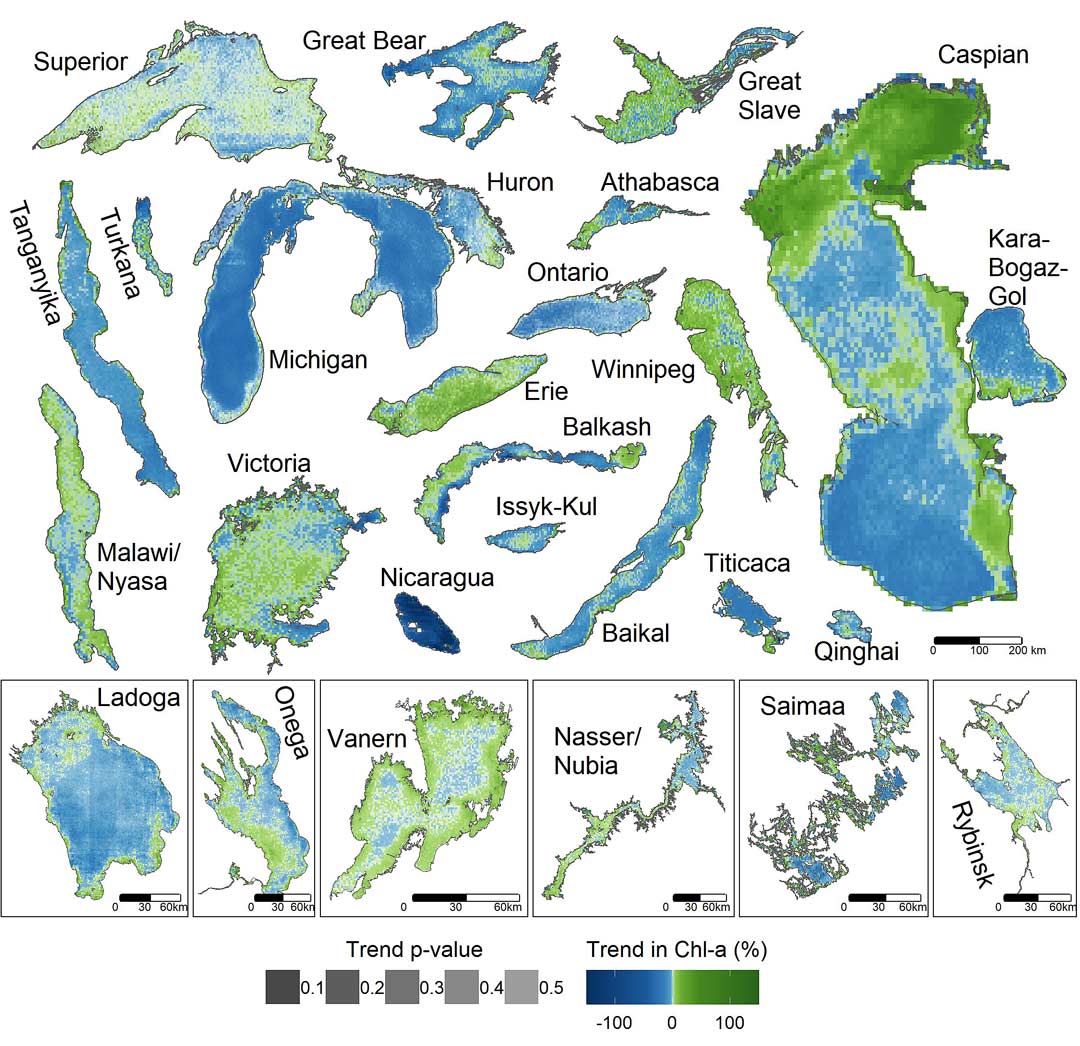




 “Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich vom Tod von Barbara Stamm erfahren. Sie war Bayerns soziales Gewissen, Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen. Barbara Stamm hat sich immer für die Belange der Bürgerinnen und Bürger stark gemacht, ihr großes Herz gehörte den Familien und ganz besonders den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Mit ihrer Hilfsbereitschaft und Wärme war sie ein Vorbild für viele Menschen – auch für mich ganz persönlich. Ich verneige mich vor ihrem Lebenswerk, sie wird mir als Ratgeberin und Mensch fehlen. Barbara Stamm war die bedeutendste Politikerin im Freistaat und Mutter Bayerns. Einmal von einer Sache überzeugt, konnte sie wie keine andere ihre Mitmenschen für sich gewinnen und für die gute Sache werben. Barbara Stamm war Patin für ihre Heimatregion Würzburg, wie niemand sonst vereinte sie Empathie und Lebensfreude. Ihr Einsatz, ihr ehrliches Interesse am Menschen und ihr Engagement für Bayern und darüber hinaus wird stets in wacher und dankbarer Erinnerung bleiben. Bayern wird Barbara Stamm ein ehrendes Andenken bewahren. In Gedanken sind wir bei ihrer Familie.“
“Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich vom Tod von Barbara Stamm erfahren. Sie war Bayerns soziales Gewissen, Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen. Barbara Stamm hat sich immer für die Belange der Bürgerinnen und Bürger stark gemacht, ihr großes Herz gehörte den Familien und ganz besonders den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Mit ihrer Hilfsbereitschaft und Wärme war sie ein Vorbild für viele Menschen – auch für mich ganz persönlich. Ich verneige mich vor ihrem Lebenswerk, sie wird mir als Ratgeberin und Mensch fehlen. Barbara Stamm war die bedeutendste Politikerin im Freistaat und Mutter Bayerns. Einmal von einer Sache überzeugt, konnte sie wie keine andere ihre Mitmenschen für sich gewinnen und für die gute Sache werben. Barbara Stamm war Patin für ihre Heimatregion Würzburg, wie niemand sonst vereinte sie Empathie und Lebensfreude. Ihr Einsatz, ihr ehrliches Interesse am Menschen und ihr Engagement für Bayern und darüber hinaus wird stets in wacher und dankbarer Erinnerung bleiben. Bayern wird Barbara Stamm ein ehrendes Andenken bewahren. In Gedanken sind wir bei ihrer Familie.“